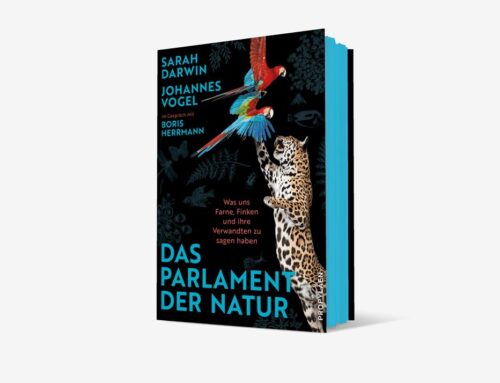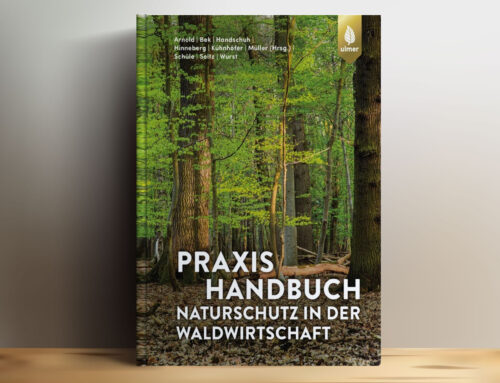Der Bundesgesetzgeber hat die naturschutz- und planungsrechtlichen Bestimmungen zugunsten des Ausbaus der Windenergiewirtschaft 2022 und zuletzt im August 2025 gravierend geschwächt. Landschaftsschutzgebiete stehen Windenergieanlagen offen und Beschränkungen von Bau und Betrieb von Windenergieanlagen im Umfeld kollisionsgefährdeter Vogelarten sind weitgehend aus dem Weg geräumt. Einigermaßen sicher vor dem weiteren Ausbau sind am ehesten die wenigen Natura 2000-Gebiete. Wenngleich die Branche selbst darin zahlreiche Anlagen mit behördlicher Genehmigung hat errichten können und ungeniert betreibt.
Zwei Gerichtsentscheidungen aus dem Mai und September 2025 vermögen zwar den fatalen Abbau rechtlicher Maßstäbe nicht zu korrigieren, sie setzen aber bestimmten Revisions- und Expansionsbestrebungen der Windenergiewirtschaft Grenzen.
In dem einen Fall ging es um den Versuch eines Anlagenbetreibers, Abschaltauflagen zu überwinden, die ihm vor Jahren aus Vogelschutzgründen auferlegt worden waren. Hierbei handelte es sich nicht allein um den Schutz der prominenten Kollisionsopfer wie den Rotmilan, sondern um kaum minder schlaggefährdete Vogelarten wie Mäusebussard und Feldlerche, die in großer Zahl als Kollisionsopfer unter den Anlagen belegt sind, aber kaum irgendwo in Deutschland die Behörden zu einem Abschalten der Anlagen oder zu Kompensationsmaßnahmen veranlasst haben. In einigen Teilen Niedersachsens, insbesondere im Landkreis Osnabrück auf Betreiben des Osnabrücker Umweltforums, indessen war es gelungen, zum Schutz auch dieser Arten Abschaltzeiten zu erzielen. Nun glaubten aber die Betreiber der Anlagen, sich im Nachhinein dieser Auflagen erwehren zu können. Schließlich habe der Gesetzgeber 2022 die Zahl der an Windenergieanlagen als kollisionsgefährdet eingestuften Arten begrenzt. Und Mäusebussard und Feldlerche stünden nicht auf der Liste. Der Landkreis Osnabrück hatte dem Antrag auf Auflösung der Auflagen stattgegeben. Dagegen ist das Osnabrücker Umweltforum mit einer Klage beim niedersächsischen Oberverwaltungsgericht vorgegangen. Im Mai 2025 hat das Gericht entschieden (OVG Niedersachsen 12 KS 55/24 – Urteil vom 30. Mai 2025). Die neuen Vorschriften können nicht rückwirkend auf alte, rechtskräftige Genehmigungen angewendet werden, so das Gericht.
Eigentlich gab es in der Sache kein Vertun: Nach § 74 Absatz 4 Satz 1 Alt. 1 BNatSchG sind „§ 45 b Absatz 1 bis 6 nicht anzuwenden auf bereits genehmigte Vorhaben zur Errichtung und zum Betrieb von Windenergieanlagen an Land“. Und so lag die Sache hier. Der Wortlaut ist insoweit eindeutig und vom Gesetzgeber bewusst gewählt. Denn in der Gesetzentwurfsbegründung (BT-Drs. 20/2354, S. 31) heißt es: „Durch die erstmals bundesweit eingeführte Standardisierung der artenschutzrechtlichen Signifikanzprüfung mit Blick auf den Betrieb von Windenergieanlagen an Land soll nicht zu einer erneuten Prüfung der Artenschutzrechtskonformität des Betriebs bestandskräftig genehmigter Anlagen und zum Erlass nachträglicher Anordnungen Anlass gegeben werden. Die gegenwärtige Praxis zur nachträglichen Anordnung soll durch dieses Gesetz nicht berührt werden. Deshalb finden die Regelungen des § 45 b Absatz 1 bis 6 nach dem neuen § 74 Absatz 4 keine Anwendung auf bereits bestandskräftig genehmigte Vorhaben zur Errichtung und zum Betrieb von Windenergieanlagen an Land.“ Die Frage der Rechtmäßigkeit der vom Gesetzgeber 2022 vorgenommenen Beschränkung kollisionsgefährdeter Vogelarten ist damit nicht geklärt.
In dem anderen Fall entschied das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG 7 C 10.24 – Urteil vom 11. September 2025). Der Kläger, eine anerkannte Umweltvereinigung, wandte sich gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung von fünf Windenergieanlagen im Landkreis Göttingen (Niedersachsen), die mit umfangreichen Nebenbestimmungen (u.a. Abschaltungen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in der Zeit von März bis August) zum Schutz des Rotmilans und weiterer Greifvögel verbunden ist. Die Windenergieanlagen sollen 1.300 m nord-östlich eines Vogelschutzgebiets und westlich eines Flora-Fauna-Habitat-Gebiets errichtet werden.
Das Bundesverwaltungsgericht hat das Erfordernis eines ergänzenden Verfahrens bestätigt, innerhalb dessen die fehlende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung nachzuholen sein wird. Zwar erstreckt sich der Natura 2000-Gebietsschutz grundsätzlich nicht auf gebietsexterne Flächen, auch wenn diese von im Gebiet ansässigen Vorkommen geschützter Tierarten genutzt werden. Gleichwohl sind im vorliegenden Einzelfall erhebliche Beeinträchtigungen des Vogelschutzgebiets auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts nicht offensichtlich ausgeschlossen. Zum einen können hiernach bereits Einzelverluste des Rotmilans dessen Erhaltungszustand im Schutzgebiet erheblich beeinträchtigen. Zum anderen werden die genehmigten Windenergieanlagen wiederkehrend von im Vogelschutzgebiet lebenden Rotmilanen zur Nahrungssuche in Richtung des benachbarten Flora-Fauna-Habitat-Gebiets überquert.
Genehmigungserleichterungen im Zuge der EU-Notfall-Verordnung und des Windenergieflächenbedarfsgesetzes kommen nicht in Betracht, weil im Zeitpunkt des Antrags auf die Genehmigungserleichterungen das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren bereits abgeschlossen und eine endgültige behördliche Entscheidung über die Genehmigungserteilung ergangen war.