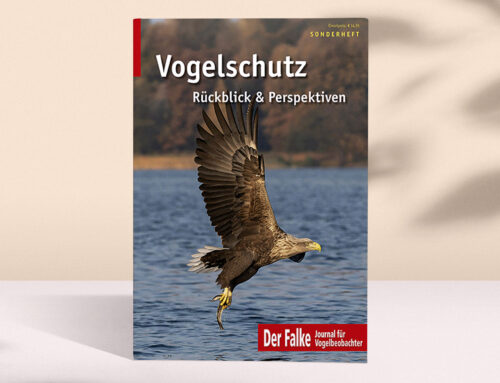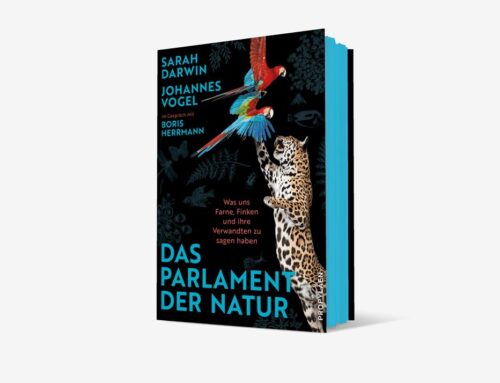In den Vorjahren standen Leser dieser Website an einem 1. April in der Gefahr, in den April geschickt zu werden. In diesem Jahr widersteht die EGE dieser Versuchung. Zum einen ist der Grat für einen zulässigen Scherz schmal geworden. Zu leicht könnte eine Meldung als Fakenews oder Delegitimierung des Staates missdeutet werden. Und zum anderen übertrifft die Wirklichkeit bisweilen die aprilscherzhafte Zuspitzung. Das lehren beispielsweise aktuelle Nachrichten über die Artenvielfalt in Solarparks, die geradezu als überwältigend beschrieben wird. Dass sich zwischen den Modulen mehr Arten anzusiedeln vermögen als in einem güllegetränkten Gras- oder Maisacker, steht gleichwohl außer Frage. Aber wird eine mit Solaranlagen überstellte eingezäunte zuvor als Acker oder Grünland genutzte Fläche deswegen schon zu einem Park? Der Neusprech hat sich in noch euphemistischere Höhen verstiegen. Abgehoben von der Wirklichkeit entstehen auf Deutschlands Fluren Biodiversitätssolarparks wie Luftschlösser. Da kann die Kirche kaum abseits stehen.
In einem Positionspapier formuliert das Bistum Münster Mindestanforderungen und Ausschlusskriterien für Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Kirchenland. Von Solarparks ausschließen will das Bistum zwar Kirchenland in Naturschutzgebieten, nicht aber in Landschaftsschutzgebieten. Dabei ist auch darin ein Anlagenbau naturschutzrechtlich kaum zulässig. Zu einem generellen Ausschluss von Solarparks bekennt sich das Papier nicht einmal in Natura 2000-Gebieten. Das Bistum mag damit seinem grünen Gewissen folgen, aber wohl auch dem Wissen um die mit Solarparks erzielbaren Pachteinnahmen von 5.000 Euro pro Hektar und Jahr. Einnahmen, die einen Hinweis auf die Gewinnspannen der Erneuerbaren Energien geben, welche ein mit dem Anbau von Feldfrüchten erzielbares Auskommen in den Schatten stellen und die Boden- und Pachtpreise für die landwirtschaftliche Nutzfläche in die Höhe treiben. Sind diese Gewinne nicht auch ein Grund für die steigenden Energiepreise, die viele Menschen zu zahlen nicht mehr in der Lage sind und deswegen von staatlichen Transferleistungen oder der Caritas abhängig sind? Sollte die Kirche nicht diese Geldmacherei kritisieren, anstatt sich daran zu beteiligen?
Das kirchliche Positionspapier steckt voller Details. Und Details sind bisweilen eine Heimstatt des Teufels. Das Papier bindet die Verwendung des Kirchenlandes für die Solarwirtschaft an inhaltsleere Nachhaltigkeitskriterien und Scheinauflagen. Es begrenzt die Versieglung auf ein Maß, das kaum ein Solarpark überschreitet, verlangt den Ausschluss von Dünger, Bioziden und Chemikalien, die darin niemand einsetzt. Es präferiert Solarparks auf landwirtschaftlich weniger ertragreichen Böden wohl aus Sorge um die Ernährungssicherheit. Allerdings sind es oftmals gerade die ertragsschwachen Böden, die mit einer höheren Artenvielfalt noch einen Beitrag zum Naturschutz leisten. Leichter zum Zuge kommen sollen Solarparks, die an einen ökologischen Begleitplan oder an ein Monitoring geknüpft sind. Doch garantiert ist damit nichts, denn Qualitätsstandards für diese Pläne gibt es nicht, und ohne ökologische Nachbesserungspflichten bleibt auch das gründlichste Monitoring im artenarmen Solarpark folgenlos. Die propagierte Anreicherung der Solarparks mit Steinhaufen und Totholz stößt auf kirchliches Wohlwollen, schadet nicht, hat aber die Qualität eines Ökozirkus. Das Bistum spekuliert bereits auf zusätzliche Ökopunkte, die als Ausgleich für neue Bauprojekte herangezogen werden können. Nach dieser Logik sind Industrieanlagen mit einem Blaumeisennistkasten Biodiversitätsfabriken.
Übrigens: Schon die moderat erscheinende Zielmarke eines Anteils von 0,5 Prozent Freiflächen-Solarparks in Deutschland entspricht mit 178.000 Hektar der Fläche von 2.825 landwirtschaftlichen Betrieben. Das Bistum Münster hält eine Verwendung des jeweiligen Kirchenlandes bis zu einem Anteil von zehn Prozent kirchenaufsichtlich für grundsätzlich genehmigungsfähig. Die Kirchen in Deutschland besitzen mehr als 380.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche.