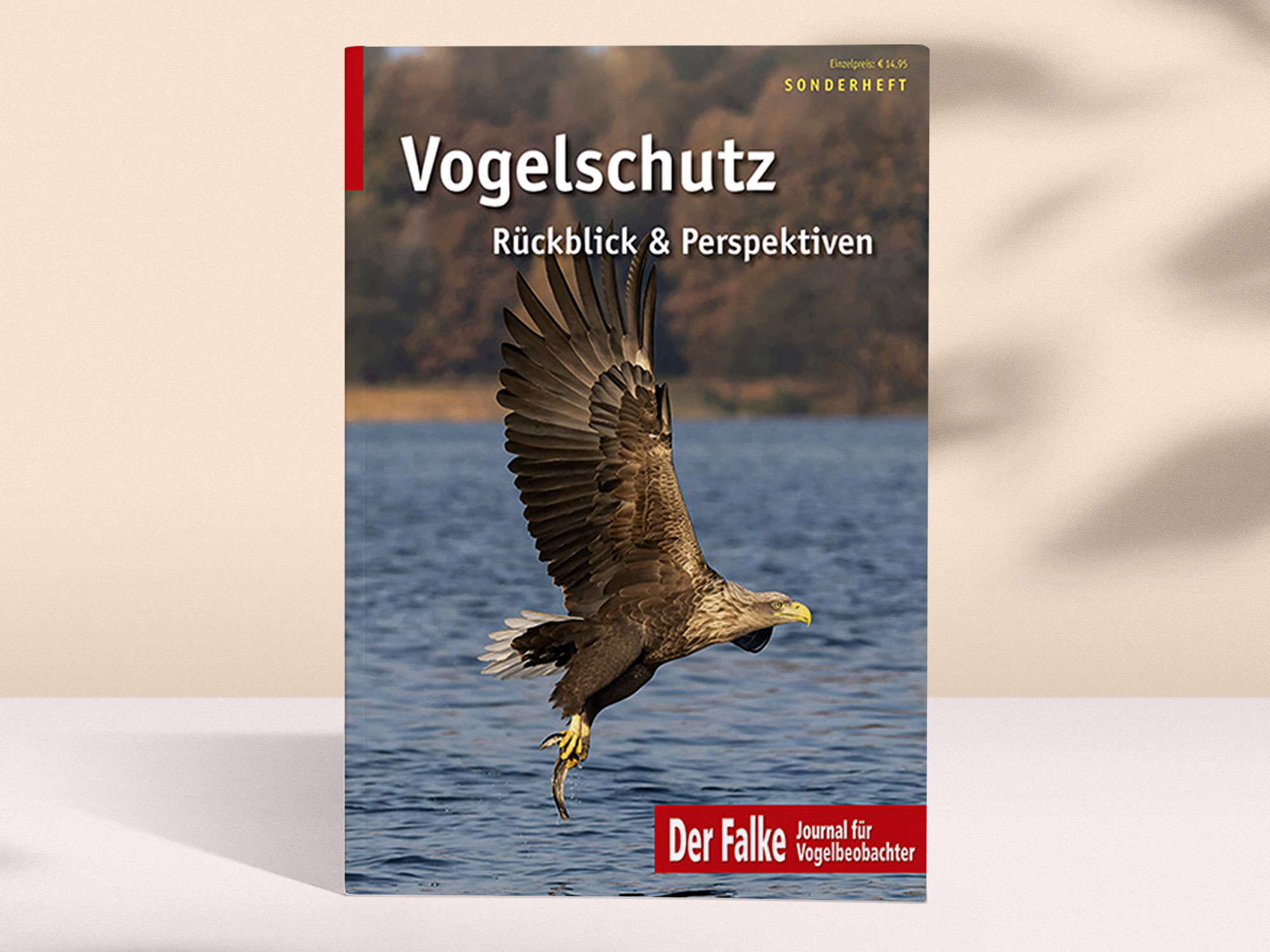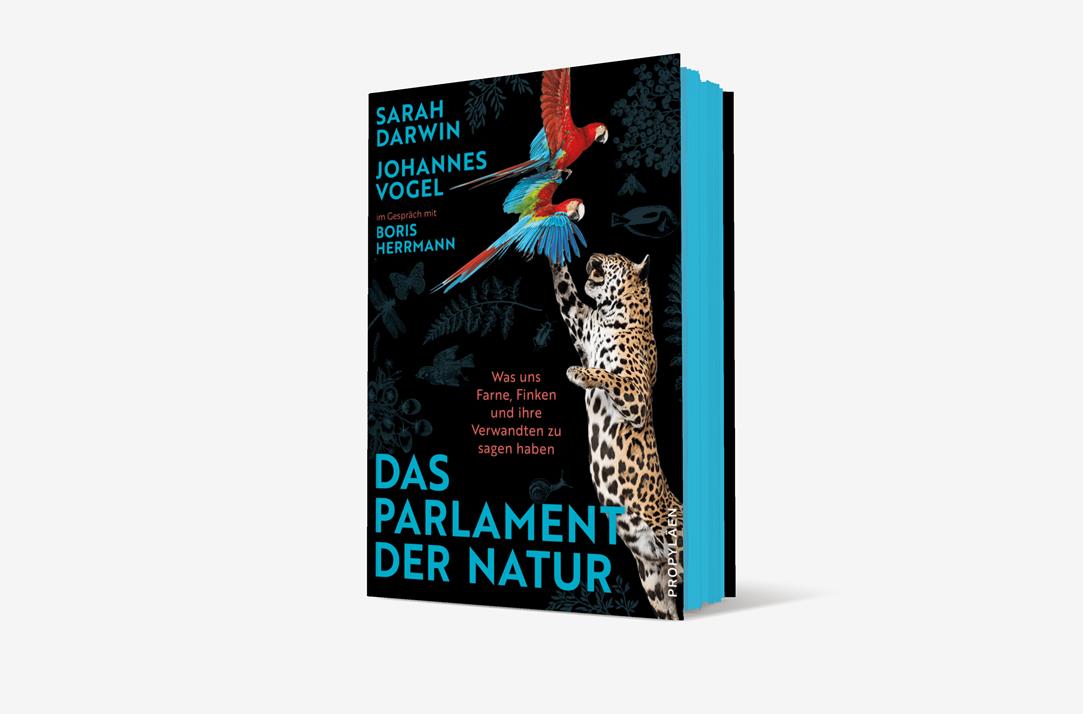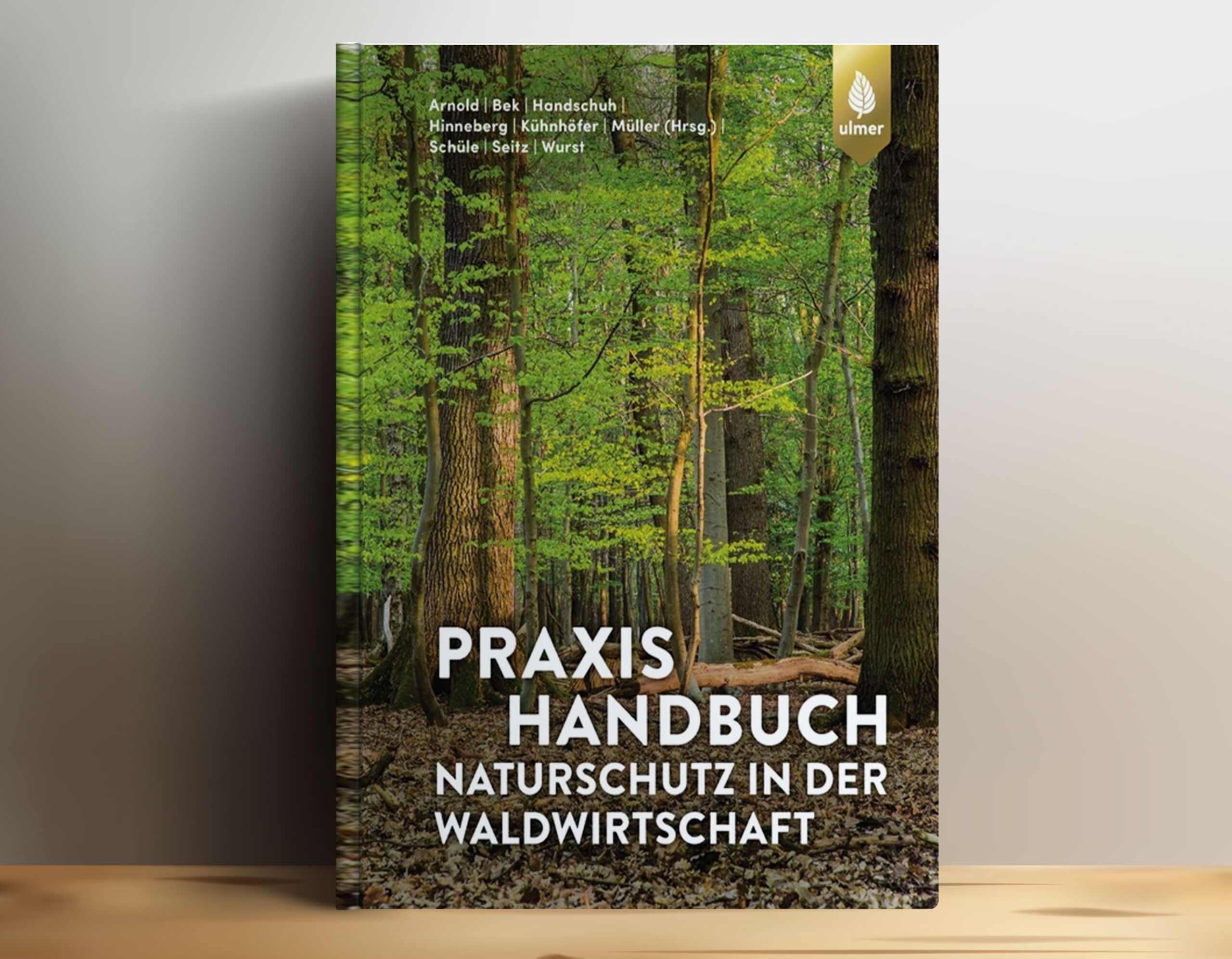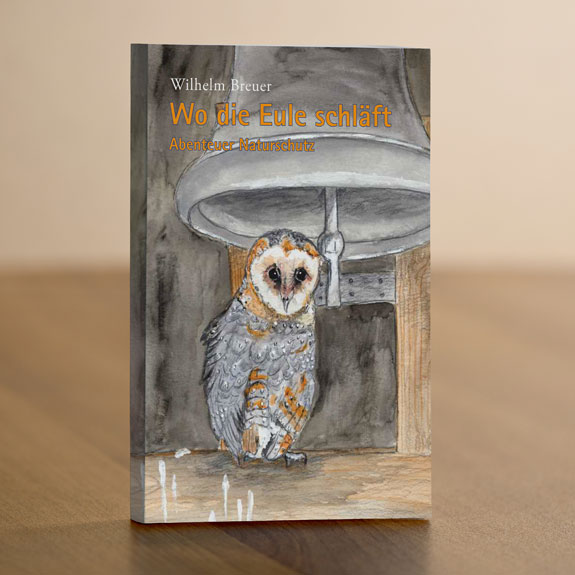Die Zwergohreule in Kärnten
Kärnten ist das südlichste Bundesland der Republik Österreich. Landeshauptstadt ist Klagenfurt am Wörthersee. An Kärnten grenzen im Westen das Bundesland Tirol, im Norden das Land Salzburg, im Norden und Osten die Steiermark und im Süden Italien und Slowenien. In Kärnten gibt es eine Gruppe Vogelschützer, die sich mit dem Schutz der Zwergohreule befasst. Gerne weisen wir an dieser Stelle auf die Website dieser Gruppe hin. Die EGE wünscht den Eulenschützern in Kärnten viel Erfolg!
Infrastruktur-Zukunftsgesetz zu Lasten des Naturschutzes
Mit kürzester Fristsetzung erhielten die Umweltverbände am Freitag, 12.12.2025 um ca. 15:30 Uhr die Möglichkeit zur Beteiligung am 126 Seiten umfassenden Referentenentwurf zum Infrastruktur-Zukunftsgesetz. Die Frist endete am Montag, 15.12.2025 um 10 Uhr. Obwohl dieser Gesetzesentwurf mit erheblichen negativen Auswirkungen auf Natur und Umwelt verbunden sei, ließe sich die Vorlage in dieser Frist nicht vollumfänglich prüfen, beklagt der Bundesverband Beruflicher Naturschutz (BBN). Die Kürze der Frist, zudem über ein Wochenende, könne nur so interpretiert werden, dass die Bundesregierung nicht an einer fundierten Stellungnahme des BBN und der anderen kontaktierten Umweltorganisationen interessiert sei oder eine solche sogar ausschließen wolle. Ein solches Verhalten trage zu einer weiteren Parteien- und Politikverdrossenheit bei, die letztlich die Demokratie schwäche. Der BBN forderte die Ministerien auf, bei allen Gesetzgebungsverfahren den jeweils betroffenen Akteuren ausreichend Zeit für fachlich fundierte Stellungnahmen einzuräumen.
Hintergrund des Infrastruktur-Zukunftsgesetzes ist der im Koalitionsvertrag der Bundesregierung beschlossene Abbau natur- und artenschutzrechtlicher Vorschriften. Den Ton für diese Bestrebungen setzte bei Zeitonline am 11.12.2025 der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der beklagte: „Jede Maus und jeder Lurch führt dazu, dass wir jahrelange Verzögerungen haben.“
Die Regelungen des geplanten Infrastruktur-Zukunftsgesetzes sind beunruhigend. Zu befürchten sind nach Angaben der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen (EGE) u. a. weitreichende Änderungen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes:
- die Ausweitung des Kompensationsraumes auf angrenzende Naturräume, d. h. eine weitere Entkopplung von Eingriff und Kompensation,
- die Anrechenbarkeit von Kompensationsmaßnahmen auf die Verpflichtungen der EU-Wiederherstellungsverordnung und andere nationale Pflichtaufgaben (z. B. zum Aufbau des Biotopverbundes), d. h. im Ergebnis ein Weniger an Naturschutz,
- die verfassungsrechtlich umstrittene Gleichstellung ungleicher Kompensationsoptionen, nämlich von monetärer und naturaler Kompensation, welche bereits der Koalitionsvertrag der Bundesregierung von 2009 vorsah, aber vernünftigerweise aufgegeben worden war,
- die Ermächtigung des Bundesumweltministeriums, in einer Rechtsverordnung nähere Bestimmungen zu dieser Gleichstellung zu treffen,
- die Ersatzzahlungen sollen nicht mehr nach Maßgabe der Ländernaturschutzgesetze für den Naturschutz in den Bundesländern verwendet werden, sondern an das Bundesumweltministerium fließen,
- der Erlass von Verwaltungsvorschriften des Bundesumweltministeriums zum Artenschutz. Hier dürfte für zahlreiche Eingriffsvorhaben geplant sein, was zugunsten der Windenergiewirtschaft bereits seit 2022 gesetzlich verankert ist: der Abbau von Zulassungshürden, die Reduktion der zu berücksichtigenden Tierarten und statt effektiver Schutzmaßnahmen die Auswahl von Minderungsmaßnahmen mit ungeklärter oder fehlender Wirksamkeit.
Die Gesetzesänderungen dürften eine Reihe von Arbeitsaufträgen für Anwendungshilfen nach sich ziehen. Sie gehen vermutlich nicht an die zuständigen Fachbehörden des Naturschutzes, sondern um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen wie in den letzten Jahren eher an kooperative Universitäten und staatlich finanzierte Nichtregierungsorganisationen.
Damit nehmen die Bestrebungen, die Kompensationspflichten für Eingriffe in Natur und Landschaft abzusenken, weiter an Fahrt auf. Zudem setzt sich die Tendenz fort, in der Eingriffsregelung nicht die Verpflichtung zur bestmöglichen Kompensation konkreter Eingriffsfolgen zu sehen, sondern ein Flächenbeschaffungs- und Finanzierungsinstrument für Pflichtaufgaben des Naturschutzes. Im Ergebnis wächst der Abstand zwischen Anspruch und Wirklichkeit der 1976 geschaffenen Eingriffs-Ausgleichsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes.
Zu dieser Entkernung des Naturschutzrechts trägt nach Auffassung der EGE auf dem Gebiet des Journalismus der weitgehende Ausfall kritischer Analyse und Berichterstattung über umweltpolitische Vorgänge bei. In weniger als einer Legislaturperiode werde verspielt, was von den Naturschutzorganisationen in den 1970er Jahren ohne staatliche Transferleistungen unter ungleich schwierigeren Bedingungen erreicht worden sei.
Rückblick: EGE-Steinkauzprojekt im Jahr 2025
Der Steinkauz zählt in Deutschland zu den gefährdeten Brutvogelarten. Der größte Teil des deutschen Brutbestandes befindet sich mit ungefähr 5.000 Paaren in Nordrhein-Westfalen. Dieses Bundesland trägt für den Schutz dieser streng geschützten Art eine nationale Verantwortung. Die Niederrheinische Bucht ist eines der Dichtezentren des Steinkauzes in Deutschland. Hier liegt das Steinkauz-Projektgebiet der EGE. Es umfasst die Kreise Düren und Euskirchen, den Rhein-Erft-Kreis und den linksrheinischen Teil des Rhein-Sieg-Kreises. Der Rhein-Erft-Kreis wird in Kooperation mit dem NABU Rhein-Erft-Kreis und dem NABU Köln, der linksrheinische Teil des Rhein-Sieg-Kreises in Kooperation mit dem NABU Bonn bearbeitet. Das Projekt umfasst die jährlichen Bestandskontrollen (einschließlich Beringung), Bau, Reparatur, Anbringen und Wartung der Nisthilfen, Schutz und Erhalt von Steinkauzlebensräumen sowie Öffentlichkeitsarbeit.
Für den Rhein-Sieg-Kreis hat sich ein kleines Team von Steinkauzschützern um Andrea Caviezel gebildet. Die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch mit dem NABU Bonn (Peter Meyer) ist verstärkt fortgesetzt worden. Andrea Caviezel ist in der Saison 2025 zur EGE gestoßen und nimmt zunehmend Verantwortung innerhalb des Steinkauzprojektes wahr.
Im Kreis Euskirchen wurde die von der Biologischen Station im Kreis Euskirchen, der Eifelstiftung und der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen gestartete Initiative fortgesetzt, welche Menschen für den Schutz des Steinkauzes zu gewinnen versucht. In dieser Region betreuten in der Vergangenheit Peter Josef Müller, Rita Edelburg-Müller zusammen mit weiteren Personen seit mehr als 25 Jahren das Steinkauzprojekt der EGE. Diesem Projekt ist die Erholung der Steinkauzbestände im Kreis Euskirchen von 30-40 Revierpaaren im Jahr 2000 auf heute etwa 170 Revierpaare zu verdanken.
In diesem Jahr wurden im Projektgebiet 517 besetzte Steinkauzreviere registriert. Das sind fünf mehr als im Vorjahr. Die Zahl der erfolgreichen Bruten stieg im Vorjahresvergleich um 30 auf 308. Die Zahl beringter Jungvögel sank allerdings von 856 auf 703. Die deutlich gesunkene Jungenzahl ist eine Folge der Nahrungsverknappung. Immerhin ist die Zahl der besetzten Steinkauzreviere sowie die Zahl der erfolgreichen Bruten im Vergleich zu 2024 leicht gestiegen.
Die Ergebnisse für das Jahr 2025 aus dem Kreis Düren, also einem der vier betreuten Kreise der Niederrheinischen Bucht, hat Doris Siehoff exemplarisch zusammengefasst. Klicken Sie bitte hier, wenn Sie ihren Bericht lesen möchten.
Silvesterfeuerwerk-Nachlese
Zum Jahresbeginn fehlt es nicht an guten Vorsätzen. Dazu könnte der Verzicht auf das Silvesterfeuerwerk an der Wende zum Jahr 2027 und besser noch eines jeden neuen Jahres gehören. Glaubt man den Umfragen, sind 59 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen für ein gesetzliches Silvesterböllerverbot. Ein Bündnis vieler Organisationen hat dem Bundesinnenministerium eine Liste mit einer Million Unterschriften für ein Verbot privater Silvesterfeuerwerke übergeben. Minister Dobrindt ließ sich dem Vernehmen nach bei der Übergabe nicht blicken.
Die Folgen der archaischen Böllerei haben sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt: Schwere Verletzungen und Todesfälle, mit Böllern angegriffene Einsatzkräfte, enorme Schäden für die Umwelt, tausende Tonnen Böller-Müll und eine Nacht des Schreckens für Millionen von Haus- und Wildtieren. Betroffen sind beispielweise die im ländlichen Raum, in der Peripherie und innerhalb der Ortschaften, auch am Rande der großen Städte, oft gemeinschaftlich in großer Zahl überwinternden Waldohreulen. Das entfesselte Höllenspektakel aus Lichtblitzen und ohrenbetäubendem Lärm verjagt die Eulen aus ihren Verstecken, schlägt sie rastlos in die Flucht und vereitelt die akustische Ortung ihrer Beutetiere. Dabei ist es für die Eulen schon in einer ruhigen Nacht in der ebenso aus- wie aufgeräumten Alltagsumgebung kaum mehr möglich, an Mäuse zu gelangen.
Der Jahreswechsel bescherte der Feuerwerksbranche Ende 2025 in Deutschland einen Rekordumsatz von mehr als 200 Millionen Euro. Der Staat verdient am Feuerwerk mit der Mehrwertsteuer auf den Verkaufspreis und indirekt durch weitere Steuern aus der Branche wie Umsatz- und Einkommensteuer. Es sind Einnahmen auf Kosten der Wildtiere.
In den Niederlanden wird privates Silvesterfeuerwerk ab dem Jahreswechsel 2026/2027 vollständig verboten, um Verletzungen, Sachschäden und Stress für Menschen und Tiere zu reduzieren; erlaubt bleiben lediglich professionelle Shows und genehmigte Veranstaltungen von Vereinen.
Sonderheft Vogelschutz erschienen
Ende 2025 erschien das Sonderheft Vogelschutz der Zeitschrift „Der Falke“. In diesem 72 Seiten umfassenden Heft werden aktuelle Themen aufgegriffen, brennende Fragen des Vogelschutzes beantwortet und motivierende Vogelschutzprojekte vorgestellt. Die Übersicht über das gesamte Heft finden Sie hier: www.falke-journal.de.
In diesem Sonderheft finden Sie u. a. den Beitrag von EGE-Geschäftsführer Wilhelm Breuer mit dem Titel: Erfolge, Enttäuschungen, Erfordernisse: Vom Recht der Vögel. In der Einleitung dieses Beitrages heißt es:
„Einige Vogelarten trotzen der Zivilisationslandschaft, arrangieren sich mit Technotopen, ziehen die Stadt dem für Vögel unwirtlichen Land vor, etablieren sich als Neozoen, profitieren von glücklichen Umständen wie dem Ende der Verfolgung und erstehen wie Phönix aus der Asche. Dagegen steht die Vielzahl der Arten, die in Deutschland unterhalb des Existenzminimums die Roten Listen füllt. Diesen Arten fehlt es am Nötigsten, an halbwegs ungestörten Habitaten, an Sicherheit und Nahrung. Die anhaltenden dramatischen Individuenverluste dieser Arten markieren ein Staatsversagen. Dessen Überwindung verlangt nicht zuletzt gesetzgeberisches und behördliches Handeln, im Ergebnis eine Art Grundsicherung und ein Recht auf Zukunft für diese Arten ihretwegen und der Menschen wegen. Aber ist nicht alles dies längst erreicht und mehr als das?“
Die EGE veröffentlicht diesen Beitrag hier mit freundlicher Genehmigung der AULA-Verlag GmbH.
Frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2026
Herzlichen Dank sagt die EGE allen Personen, Verbänden, Stellen und Einrichtungen, die mit Anregungen, Lob und Tadel, auf ideelle oder finanzielle Weise im zu Ende gehenden Jahr die Anliegen der EGE unterstützt haben. Wenn Sie das alte Jahr mit einer guten Tat beenden oder das neue mit einer solchen beginnen möchten, bedenken Sie bitte die EGE mit Ihrer Spende. Ohne Ihre Unterstützung könnte die EGE nur wenig bis nichts erreichen. Selbstverständlich erhalten Sie über Ihre Spende eine Spendenbescheinigung. Klicken Sie bitte hier, wenn Sie den diesjährigen Weihnachtsbrief der EGE lesen möchten. Den Jahresbericht der EGE für das Jahr 2025 finden Sie hier.
Die EGE wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
Neue Ausgabe von Nationalpark erschienen
Die neun Beiträge der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Nationalpark gelten den Vögeln, ihrer Gefährdung und ihrem Schutz. Das Heft richtet den Blick auf die Situation der Vögel in den Kriegsgebieten in der Ukraine. Ganze Landstriche sind verwüstet und verseucht, Brutvogelhabitate zerstört und die Zugrouten der wandernden Arten beeinträchtigt. Möge dieser Krieg endlich enden. Zu einem Ende kam glücklicherweise schon vor längerer Zeit in Deutschland und in anderen Staaten der Europäischen Union die Verfolgung von Kolkrabe und Saatkrähe. Im neuen Heft werden die beiden schwarzen Vogelgestalten vorgestellt und obendrein der Hausrotschwanz, bevor ihm das Rebhuhn als Vogel des Jahres 2026 folgen wird. Weitere Beiträge ergründen u. a. die Bedeutung des Totholzes für das Vogelleben, vermitteln von der niedersächsischen Küste teils erschütternde Details aus den dortigen Europäischen Vogelschutzgebieten, die – so ein anderer Heftbeitrag – „so schön sein könnten“, würde darin eingelöst, was zum Schutz der Küstenvögel seit Jahrzehnten gesetzlich verlangt ist. Überdies in diesem Heft: Beiträge über Glücksvögel, das Steinhuder Meer und der Blick auf die gegenwärtige Lage von Vogelschutz und Vogelschützern mit Analogien zu Roman und Film „Die Zeitmaschine“.
Die Zeitschrift Nationalpark berichtet auf 46 Seiten viermal jährlich über die Entwicklung deutscher Nationalparke, große Schutzgebiete und aus dem Naturschutz. Die Zeitschrift leistet sich, was in der deutschen Zeitschriftenlandschaft eine Ausnahme ist: einen unabhängigen, kritischen und fundierten Blick auf die Sache des Naturschutzes. Die EGE empfiehlt die auf 100% Recyclingpapier gedruckte Zeitschrift mit den Worten, die der Journalist Horst Stern für sie gefunden hat: „Besser kann man Papier aus dem Holz der Bäume nicht nutzen“. Vielleicht möchten Sie die Zeitschrift mit einem Probe-Abo kennenlernen oder mit einem Geschenk-Abo helfen, sie bekannter zu machen. Zur aktuellen Ausgabe gelangen Sie hier.
Deutschland im Herbst der Reformen
Die deutsche Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD hat einen Politikwechsel versprochen, im Naturschutz allerdings keine großen Änderungen in Aussicht gestellt, sondern in ihrer Koalitionsvereinbarung eher ein „Weiter so“ angekündigt – und damit die Fortsetzung des von der Ampelkoalition begonnenen Abbaus der in einem halben Jahrhundert deutscher Naturschutz-Rechtsgeschichte errungenen Standards.
Im Fadenkreuz der Koalition stehen die beiden zentralen Bereiche des Naturschutzrechts: die Eingriffsregelung und das Artenschutzrecht. Hier setzt der Referentenentwurf des Infrastruktur-Zukunftsgesetzes des Bundesministeriums für Verkehr vom 07.11.2025 an:
Die Eingriffsfolgen neuer Eingriffe sollen künftig nicht nur in dem vom Eingriff betroffenen Naturraum, sondern auch in angrenzenden Naturräumen kompensiert werden können und damit Eingriffs- und Kompensationsort noch stärker entkoppelt werden.
Wiederherstellungsmaßnahmen nach der EU-Wiederherstellungsverordnung sollen einer Anerkennung als Kompensationsmaßnahmen nicht entgegenstehen. Damit können unionsrechtlich geschuldete Maßnahmen auf Kompensationsverpflichtungen angerechnet werden, was zu einer Reduzierung von Naturschutzleistungen führen kann.
Die monetäre Kompensation soll der naturalen Kompensation gleichgestellt werden, so dass der Eingriffsverursacher wählen kann, ob er mit realen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege die vom Eingriff ausgelösten Schäden kompensiert oder sich mit einer Geldzahlung dieser Pflicht entzieht. Die Zahlungen können zur Realisierung bestehender Pflichtaufgaben des Naturschutzes verwendet werden, beispielsweise für die Einlösung unions- oder bundesrechtlich geschuldeter Naturschutzleistungen. Dies bedeutet im Ergebnis kein Mehr, sondern ein Weniger an Naturschutz. Die Gleichstellung monetärer und naturaler Kompensation war bereits 2009 im Koalitionsvertrag der christlich-liberalen Bundesregierung auf Betreiben der FDP vereinbart, nach heftiger Kritik und verfassungsrechtlicher Bedenken gegen eine Gleichstellung nicht gleichermaßen geeigneter Optionen aber nicht ins Werk gesetzt worden. Wie der Verzicht auf naturale Maßnahmen in Geldbeträge umgerechnet werden soll, soll das Bundesumweltministerium in einer Rechtsverordnung festlegen.
Der Umfang von Bestandsaufnahmen artenschutzrechtlich zu beachtender Arten und ggf. zu ihrem Schutz zu ergreifender Maßnahmen sollen in Verwaltungsvorschriften des Bundesumweltministeriums festgelegt werden. Hier steht zu erwarten, was zugunsten der Windenergiewirtschaft bereits seit 2022 auf Betreiben von Bündnis90/DieGrünen gesetzlich verankert ist: die begründungslose Reduktion der zu berücksichtigenden Arten und statt effektiver Schutzmaßnahmen die Auswahl von Maßnahmen mit ungeklärter oder fehlender Wirksamkeit.
Die geplanten Gesetzesänderungen werden Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften nach sich ziehen. Die Vorarbeiten dazu gehen vermutlich nicht an das Bundesamt für Naturschutz, sondern um die politisch gewünschten Ergebnisse zu erzielen eher an Universitäten und staatlich alimentierte Nichtregierungsorganisationen. Auf den Herbst der Reformen dürfte ein langer Winter folgen.
Für Sie gelesen: Das Parlament der Natur
Das Buch über Evolution, Biologie und Biodiversität umfasst die Gespräche, die der US-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung (SZ) mit der Charles Darwin-Ururenkelin und dem Generaldirektor des Berliner Naturkundemuseums (nach Meinung der SZ „das Traumpaar der Naturforschung“) geführt hat. Die Autoren wollen „die wissensbasierte demokratische Gesellschaft stärken, um die notwendigen politischen Mehrheiten zum Handeln zu gewinnen“. Deshalb sei „ihr leidenschaftliches Gespräch über Natur zugleich eines über Politik“. Die Interviews fördern eine Mischung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, politischer Standpunkte und weltanschaulicher Haltungen zu Tage; darunter die Zustimmung zu Milliardenausgaben für die Bundeswehr ebenso wie insinuierende Warnungen vor Elon Musk, Putin, J.D. Vance, Marine Le Pen und Alice Weidel. Überdies gibt das reich illustrierte Buch, einer Homestory nicht unähnlich, Einblick in das berufliche wie private Umfeld der beiden Interviewten. Von den 78 großenteils großformatigen Fotos zeigen 39 Ansichten, Räume und Präparate des Berliner Naturkundemuseums und 14 die beiden Protagonisten. Rätselhaft bleibt, was man sich unter der im Buch angekündigten „Weltrettungsmaschine“ vorstellen darf, deren Kosten mit „vielleicht 100 Milliarden“ schon einmal beziffert sind. Das Buch geizt nicht mit Zeitgeist, Selbstgewissheiten und Selbstinszenierung. Nach Verlagsbekunden steht der Propyläen Verlag „für anspruchsvolle und fundierte Bücher aus Geschichte, Zeitgeschichte, Politik und Kultur“.
Wilhelm Breuer
Sarah Darwin, Johannes Vogel, Boris Herrmann
Das Parlament der Natur
Was uns Farne, Finken und ihre Verwandten zu sagen haben
240 Seiten, Propyläen Verlag. 2025 Ullstein Buchverlage GmbH Berlin
Hardcover mit Schutzumschlag, ISBN 9783549100899, DE 36,00 €, AT 37,10 €
Hoffnungen auf neue EU-Verordnung?
Der Naturschutz sieht sich heute mehr denn je in Frage gestellt. Die guten Jahre liegen hinter uns, sagen manche Insider aus Naturschutzbehörden und -vereinigungen. Sie verweisen dabei insbesondere auf die 1970er Jahre. Sie waren ein Jahrzehnt des Naturschutzes, in welchem trotz zahlreicher Rückschläge beachtliche Erfolge erreicht worden sind. Dazu zählen beispielsweise die rechtliche Verankerung der Naturschutzziele, die Einrichtung großer Schutzgebiete wie Nationalparke und Biosphärenreservate, die Etablierung einer prinzipiell leistungsfähigen Naturschutzverwaltung sowie gewährte Mitwirkungs- und Klagerechte der Naturschutzvereinigungen. In Deutschland und im Gebiet der Europäischen Union gehört zum Erfolg nicht zuletzt der Aufbau des europäischen ökologischen Netzes Natura 2000. Dieses Netz basiert auf zwei Richtlinien der Europäischen Union: der Vogelschutzrichtlinie von 1979 und der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie von 1992.
Mit einer neuen Rechtsgrundlage der Europäischen Union verbinden sich Hoffnungen auf neue Erfolge im Naturschutz: das Nature Restoration Law, kurz EU-Wiederherstellungsverordnung. Was hat es mit dieser bereits im August 2024 in Kraft getretenen Verordnung auf sich und wie berechtigt sind die Erwartungen, dass sich mit ihr die Dinge zum Besseren wenden und beispielsweise die in Deutschland über Jahrhunderte entwässerten und kultivierten Hoch- und Niedermoore endlich in einem größeren Umfang wiedervernässt werden? Denn auch die Wiederherstellung dieser Lebensräume ist nun unionsrechtlich verlangt. EGE-Geschäftsführer Wilhelm Breuer hat in die Wiederherstellungsverordnung der EU geschaut. Übermäßig groß sind seine Hoffnungen allerdings nicht. Seinen Kommentar zum Nature Restoration Law finden Sie hier. Der Kommentar erschien in der aktuellen Ausgabe der „Umweltzeitung – Magazin für Politik, Ökologie und eine lebenswerte Zukunft“. Diese Ausgabe widmet sich der Zukunft der Moore.
Praxishandbuch Naturschutz in der Waldwirtschaft
Knapp ein Drittel Deutschlands ist von Wald bedeckt. Das forstwirtschaftliche Flächenmanagement ist die wichtigste Gefährdungsursache des Waldes und seiner Biodiversität. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen einschließlich der Biodiversität könnte in vorbildlicher Weise in den Staatsforstbetrieben und im Körperschaftswald erreicht werden. Im Privatwald erfordert der Naturschutz als Untergrenze eine normativ konkretisierte „gute forstliche Praxis“. Beides ist weder im Waldrecht noch im Naturschutzrecht hinreichend gewährleistet. Überdies hat der Gesetzgeber die forstwirtschaftlichen Produktionsweisen von natur- und artenschutzrechtlichen Beschränkungen weitgehend ausgenommen.
Um alles dies geht es in dem auf einer Reihe von forstwirtschaftlichen Fortbildungsveranstaltungen in Baden-Württemberg basierenden Buch nicht. Die Autoren aus Forstwirtschaft und Waldökologie plädieren gleichwohl für mehr Naturschutz im Wald, insbesondere für eine stärkere Integration der Biotop- und Habitatansprüche ausgewählter waldbewohnender Tierarten im Wirtschaftswald. So gelten 70 Prozent der 194 Buchseiten dem Schutz holzbewohnender Käfer (23 S.), der Waldfledermäuse (38 S.), Spechte (18 S.), Eulen (8 S.), Tagfalter und Widderchen (24 S.), Amphibien (25 S.) und des Schwarzstorchs (4 S.). Die Autoren legen auf fundierte und anschauliche Weise dar, was zum Schutz dieser Arten im Waldbau unternommen oder unterlassen werden sollte. Dazu sollte allerdings, was im Buch fehlt, der Verzicht auf forstwirtschaftliche Maßnahmen auch im störungsrelevanten Umfeld von Greifvogelnestern zählen.
Die Autoren befürworten durchaus eine ungestörte Entwicklung und einen Nutzungsverzicht im Wald, begrenzen diese zur Ökologiepflichtigkeit des Waldes zählenden Erfordernisse aber auf vergleichsweise kleine Flächenanteile. Man mag darin eine Schwäche des Buches erkennen. Angesichts der realen Kräfteverhältnisse im öffentlichen und im Privatwald kann die Fokussierung auf unter diesen Umständen machbare Artenhilfsmaßnahmen aber auch eine Stärke sein, um die hierfür erforderliche Bereitschaft der Waldeigentümer und Bewirtschafter zu gewinnen. Den im Buch vorgeschlagenen Maßnahmen ist jedenfalls eine breite Akzeptanz innerhalb des eigenen Berufsstandes zu wünschen. Der Sache des Naturschutzes aber auch, dass die Ökologiepflichtigkeit im Privatwald und im öffentlichen Waldeigentum nicht allein von der Bereitschaft der Forstleute abhängt, sondern die dringend erforderliche rechtliche Verankerung erfährt.
Wilhelm Breuer
Andreas Arnold, Hans-Joachim Bek, Markus Handschuh, Heiko Hinneberg, Andreas Kühnhöfer, Jochen Müller, Peter Schüle, Winfried Seitz, Claus Wurst
Praxishandbuch Naturschutz in der Waldwirtschaft
194 Seiten, 216 Fotos; 2024 Eugen Ulmer 2025, ISBN 978-3-8186-2029-5, € 44,-
Wohnraum für Waldohreulen
Die Herbststürme zerren an den löchrigen Krähen-, Elstern-, Tauben- und Greifvogelnestern des letzten Sommers. Bei Ausgang des Winters wird von vielen alten Nestern nicht mehr viel übrig sein. Dabei ist eine Eulenart als Nachmieter auf die Secondhand-Nestunterlage aus Reisig angewiesen: die Waldohreule. Der Mangel an alten Nestern limitiert den Brutbestand der Eule selbst dort, wo die Jagd auf Wühlmäuse ausreichend Erfolg verspricht, um vier oder fünf Jungvögel aufzuziehen. Das gilt für grünlandreiche Landschaften und selbst die Peripherie der Dörfer und Städte und manchmal sogar für die Parks, Friedhöfe und Gartensiedlungen in den Großstädten. Die Knappheit an Nestunterlagen für Waldohreulen lässt sich vergleichsweise leicht beheben. Die Produktkataloge der Firmen für den praktischen Vogelschutz bieten Abhilfe: Nistkörbe, die mit Reisig oder Rindenmulch gefüllt fest in den Bäumen verankert werden. Sozialer Wohnungsbau für die Eule mit den Federohren.
Im niedersächsischen Landkreis Schaumburg schaffen auf Initiative von Karl Heinrich Meyer die Eulenschützer den Waldohreulen indessen auf ganz kreative Weise eine sichere Unterlage fürs Gelege. Dort hat sich eine Gruppe zusammengetan, die aus Weidenruten unter fachkundiger Anleitung der Korbmacherin Uschi Gerhards Körbe für Waldohreulen schafft und damit für ein Angebot an soliden Reviermittelpunkten für Waldohreulen sorgt. Das Motto der von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung geförderten Aktion lautet: Nistkörbe für Waldohreulen – Handwerk trifft Artenschutz.
Die Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen gratuliert Initiatoren und Team der Korbflechter zu der Aktion. Allen herzlichen Dank für so viel Gemeinsinn für mehr Artenschutz im Siedlungsraum. Denn dort finden sich mit der richtigen Nestunterlage Waldohreulen durchaus als Nachbarn der Menschen ein. Ein Erlebnis für Alt und Jung und ein Ereignis, an dem vor allem Kinder Freude haben und sie in Kontakt bringt mit der Natur.
Eulen-Adventskalender jetzt bestellen
Adventskalender bereiten Freude und verkürzen das Warten auf Weihnachten. Aber nur die Adventskalender der EGE werben zudem für den Schutz der Eulen. Bei der EGE sind in diesem Jahr zwei verschiedene Adventskalender erhältlich: der eine präsentiert den Uhu, der andere die Schleiereule.
Hinter den 24 Türchen des Uhu-Adventskalenders (siehe links) verbergen sich Tiere, welche in den Lebensräumen des Uhus daheim sind. Das Kalendermotiv beruht auf einem Foto von Achim Schumacher. Und hinter den Türchen des Schleiereulen-Adventskalenders (siehe rechts) stecken die Tiere der Dörfer und der Feldflur. Das Kalendermotiv beruht auf einem Aquarell von Bärbel Pott-Dörfer. Auf den Kalenderrückseiten befinden sich illustrierte Informationen über Uhu und Schleiereule. Die Tiere hinter den Türchen zeichnete Michael Papenberg. Die EGE dankt den Künstlern und den Fotografen für die kostenfreie Bereitstellung der Bilder.
Vielleicht möchten Sie Freunden und Verwandten vor dem 1. Dezember mit diesen Kalendern eine Freude machen. Die Kalender sind ein schönes Geschenk vor allem für Kinder und Enkel. Der Kalender passt in einen B 4-Umschlag und lässt sich für 1,80 Euro mit der Deutschen Post versenden. Die originellen Adventskalender (Papier: 300g/m² Circlesilk Premium White) mit den Maßen 24 x 34 cm sind nur bei der EGE erhältlich.
Die EGE erbittet für einen Kalender eine Spende von 7 Euro, bei einer Bestellung ab drei Kalender 6 Euro und ab 5 Kalender 5 Euro je Kalender. Die Versandkosten trägt die EGE. Der Erlös fließt in die Eulenschutzprojekte der EGE.
Tipp: Adventskalender und Kinderbuch im Paket
Wer den Kalender verschenkt, kann ihn wunderbar mit dem EGE-Kinderbuch „Wo die Eule schläft“ kombinieren. In sechs spannenden Kapiteln nimmt Autor Wilhelm Breuer Kinder und Jugendliche mit auf Entdeckungsreise zu Uhu, Schleiereule, Waldkauz und weiteren Arten – ergänzt durch Fakten und Porträts aller 13 europäischen Eulen. Die Aquarellzeichnungen von Bärbel Pott-Dörfer runden das handliche Buch ab, das sich besonders für Kinder zwischen 8 und 14 Jahren eignet.
So wird aus Kalender und Buch ein rundes Geschenkpaket für kleine und große Naturfreunde – eine Freude, die lange über die Adventszeit hinaus wirkt. Einen Blick ins Buch können Sie hier werfen.
Die EGE sendet Ihnen das Buch für eine Spende in Höhe von 12,50 Euro bzw. 10 Euro je Buch ab 10 Büchern versandkostenfrei zu.
Bitte richten Sie Ihre Bestellungen unter Angabe des gewünschten Motivs per E-Mail an:
Egeeulen@t-online.de
oder per Post an
EGE
Breitestraße 6
53902 Bad Münstereifel
Die Spende erbittet die EGE nach Erhalt der Lieferung auf ihr Spendenkonto
Postbank Köln
BIC PBNKDEFF
IBAN DE66370100500041108501
Stichwort Adventskalender
Leiseflieger: Die Federn des Uhus
In der August-Ausgabe 2025 der Zeitschrift „Der Falke“ erschien der Beitrag von Prof. Dr. Hans-Heiner Bergmann „Leiseflieger: Die Federn des Uhus“. Die EGE dankt der Redaktion der Zeitschrift und dem Autor, dass der Beitrag auf der Website der EGE erscheinen darf. Die Zeitschrift „Der Falke“ berichtet monatlich aus dem Leben und über den Schutz der Vögel. Klicken Sie bitte hier, wenn Sie den Beitrag lesen möchten. Mehr auf www.falke-journal.de
Über die zwölf Monatsausgaben hinaus erscheint jährlich ein Sonderheft. Das Sonderheft des Jahres 2025 erscheint im Oktober. In diesem Sonderheft von „Der Falke“ werden aktuelle Themen aufgegriffen, brennende Fragen beantwortet und motivierende Vogelschutzprojekte vorgestellt.
Zwei Urteile setzen Windenergiewirtschaft Grenzen
Der Bundesgesetzgeber hat die naturschutz- und planungsrechtlichen Bestimmungen zugunsten des Ausbaus der Windenergiewirtschaft 2022 und zuletzt im August 2025 gravierend geschwächt. Landschaftsschutzgebiete stehen Windenergieanlagen offen und Beschränkungen von Bau und Betrieb von Windenergieanlagen im Umfeld kollisionsgefährdeter Vogelarten sind weitgehend aus dem Weg geräumt. Einigermaßen sicher vor dem weiteren Ausbau sind am ehesten die wenigen Natura 2000-Gebiete. Wenngleich die Branche selbst darin zahlreiche Anlagen mit behördlicher Genehmigung hat errichten können und ungeniert betreibt.
Zwei Gerichtsentscheidungen aus dem Mai und September 2025 vermögen zwar den fatalen Abbau rechtlicher Maßstäbe nicht zu korrigieren, sie setzen aber bestimmten Revisions- und Expansionsbestrebungen der Windenergiewirtschaft Grenzen.
In dem einen Fall ging es um den Versuch eines Anlagenbetreibers, Abschaltauflagen zu überwinden, die ihm vor Jahren aus Vogelschutzgründen auferlegt worden waren. Hierbei handelte es sich nicht allein um den Schutz der prominenten Kollisionsopfer wie den Rotmilan, sondern um kaum minder schlaggefährdete Vogelarten wie Mäusebussard und Feldlerche, die in großer Zahl als Kollisionsopfer unter den Anlagen belegt sind, aber kaum irgendwo in Deutschland die Behörden zu einem Abschalten der Anlagen oder zu Kompensationsmaßnahmen veranlasst haben. In einigen Teilen Niedersachsens, insbesondere im Landkreis Osnabrück auf Betreiben des Osnabrücker Umweltforums, indessen war es gelungen, zum Schutz auch dieser Arten Abschaltzeiten zu erzielen. Nun glaubten aber die Betreiber der Anlagen, sich im Nachhinein dieser Auflagen erwehren zu können. Schließlich habe der Gesetzgeber 2022 die Zahl der an Windenergieanlagen als kollisionsgefährdet eingestuften Arten begrenzt. Und Mäusebussard und Feldlerche stünden nicht auf der Liste. Der Landkreis Osnabrück hatte dem Antrag auf Auflösung der Auflagen stattgegeben. Dagegen ist das Osnabrücker Umweltforum mit einer Klage beim niedersächsischen Oberverwaltungsgericht vorgegangen. Im Mai 2025 hat das Gericht entschieden (OVG Niedersachsen 12 KS 55/24 – Urteil vom 30. Mai 2025). Die neuen Vorschriften können nicht rückwirkend auf alte, rechtskräftige Genehmigungen angewendet werden, so das Gericht.
Eigentlich gab es in der Sache kein Vertun: Nach § 74 Absatz 4 Satz 1 Alt. 1 BNatSchG sind „§ 45 b Absatz 1 bis 6 nicht anzuwenden auf bereits genehmigte Vorhaben zur Errichtung und zum Betrieb von Windenergieanlagen an Land“. Und so lag die Sache hier. Der Wortlaut ist insoweit eindeutig und vom Gesetzgeber bewusst gewählt. Denn in der Gesetzentwurfsbegründung (BT-Drs. 20/2354, S. 31) heißt es: „Durch die erstmals bundesweit eingeführte Standardisierung der artenschutzrechtlichen Signifikanzprüfung mit Blick auf den Betrieb von Windenergieanlagen an Land soll nicht zu einer erneuten Prüfung der Artenschutzrechtskonformität des Betriebs bestandskräftig genehmigter Anlagen und zum Erlass nachträglicher Anordnungen Anlass gegeben werden. Die gegenwärtige Praxis zur nachträglichen Anordnung soll durch dieses Gesetz nicht berührt werden. Deshalb finden die Regelungen des § 45 b Absatz 1 bis 6 nach dem neuen § 74 Absatz 4 keine Anwendung auf bereits bestandskräftig genehmigte Vorhaben zur Errichtung und zum Betrieb von Windenergieanlagen an Land.“ Die Frage der Rechtmäßigkeit der vom Gesetzgeber 2022 vorgenommenen Beschränkung kollisionsgefährdeter Vogelarten ist damit nicht geklärt.
In dem anderen Fall entschied das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG 7 C 10.24 – Urteil vom 11. September 2025). Der Kläger, eine anerkannte Umweltvereinigung, wandte sich gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung von fünf Windenergieanlagen im Landkreis Göttingen (Niedersachsen), die mit umfangreichen Nebenbestimmungen (u.a. Abschaltungen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in der Zeit von März bis August) zum Schutz des Rotmilans und weiterer Greifvögel verbunden ist. Die Windenergieanlagen sollen 1.300 m nord-östlich eines Vogelschutzgebiets und westlich eines Flora-Fauna-Habitat-Gebiets errichtet werden.
Das Bundesverwaltungsgericht hat das Erfordernis eines ergänzenden Verfahrens bestätigt, innerhalb dessen die fehlende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung nachzuholen sein wird. Zwar erstreckt sich der Natura 2000-Gebietsschutz grundsätzlich nicht auf gebietsexterne Flächen, auch wenn diese von im Gebiet ansässigen Vorkommen geschützter Tierarten genutzt werden. Gleichwohl sind im vorliegenden Einzelfall erhebliche Beeinträchtigungen des Vogelschutzgebiets auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts nicht offensichtlich ausgeschlossen. Zum einen können hiernach bereits Einzelverluste des Rotmilans dessen Erhaltungszustand im Schutzgebiet erheblich beeinträchtigen. Zum anderen werden die genehmigten Windenergieanlagen wiederkehrend von im Vogelschutzgebiet lebenden Rotmilanen zur Nahrungssuche in Richtung des benachbarten Flora-Fauna-Habitat-Gebiets überquert.
Genehmigungserleichterungen im Zuge der EU-Notfall-Verordnung und des Windenergieflächenbedarfsgesetzes kommen nicht in Betracht, weil im Zeitpunkt des Antrags auf die Genehmigungserleichterungen das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren bereits abgeschlossen und eine endgültige behördliche Entscheidung über die Genehmigungserteilung ergangen war.
Beiträge von 2006 bis 2021
Nachrichtenarchiv
Wir freuen uns, dass wir auch ein Nachrichtenarchiv auf unserer Website haben, in dem Sie ältere Beiträge finden können. Das Archiv bietet Ihnen die Möglichkeit, vergangene Artikel jederzeit zu lesen und es umfasst alle Artikel, die von 2006 bis 2021 auf unserer „alten“ Website veröffentlicht wurden.